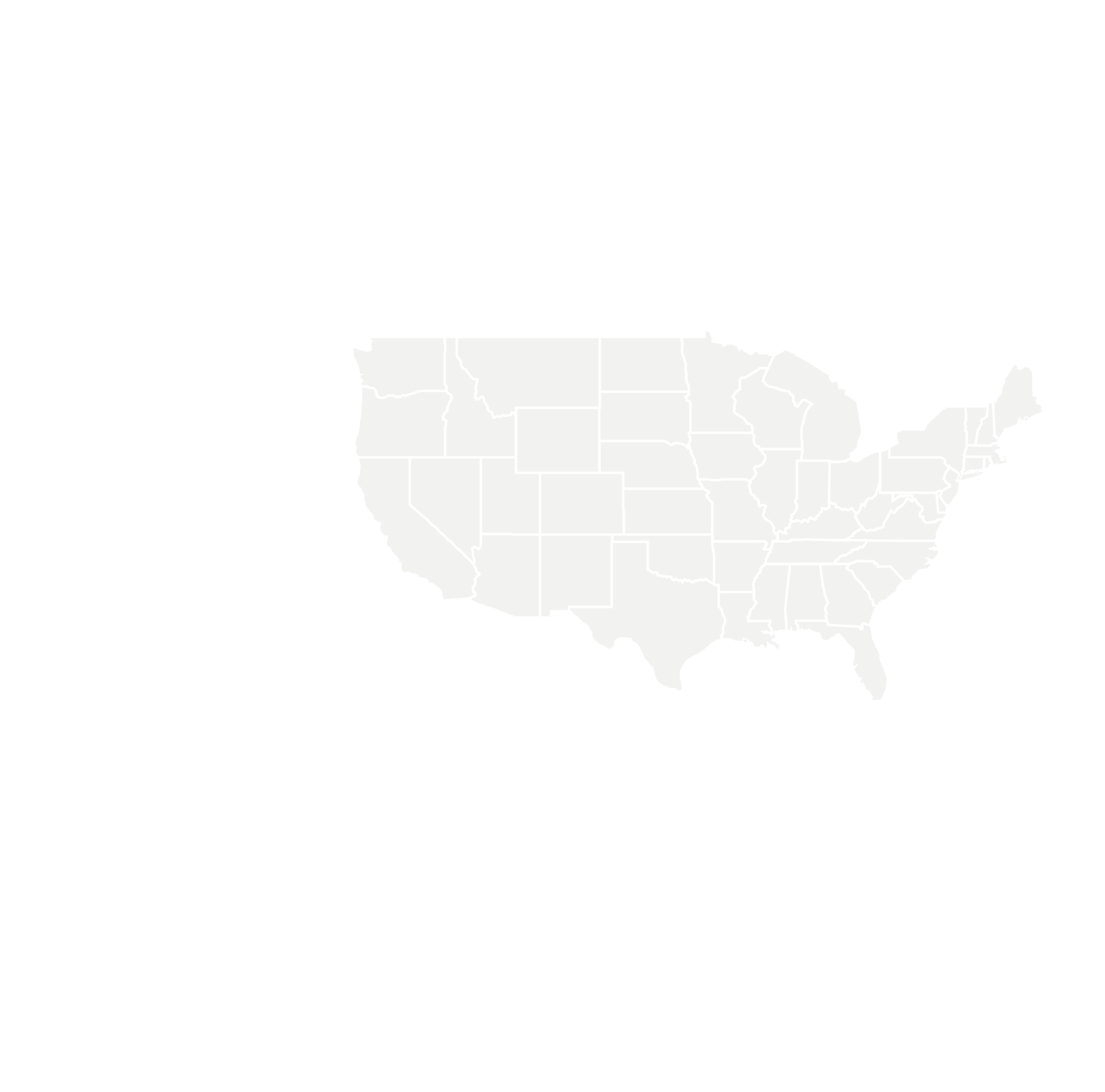Im Sommer 1946 lynchte eine vermeintlich unbekannte Gruppe von Weißen in der Nähe von Monroe, einer kleinen Stadt 45 Meilen östlich von Atlanta, Georgia, zwei junge afroamerikanische Paare. Die Morde an George W. und Mae Murray Dorsey sowie Roger und Dorothy Malcom erschütterten nicht nur Afroamerikaner*innen. Auch weiße Amerikaner*innen zeigten sich von den Ereignissen geschockt. Viele Südstaatler*innen betrauerten jedoch weniger den Mord an den vier jungen Afroamerikaner*innen. Vielmehr fürchteten sie die politischen und sozialen Folgen der Tat für Georgia und den Süden allgemein.
Rasch forderten Politiker*innen und Vertreter*innen des afroamerikanischen Bevölkerungsteils ein Eingreifen des Bundes. Der Süden, so die Argumentation, sei noch nicht in der Moderne angekommen. Die Region sei im Gegensatz zum Rest des Landes von Gesetzlosigkeit, die besonders in Lynchmorden deutlich werde, und einer ineffektiven Strafverfolgung durchzogen. Schwarze würden unterdrückt und in ihrer Existenz bedroht. Der Süden, so argumentierten Kritiker*innen aus dem Rest des Landes, müsste an den landesweiten Standard angepasst werden. Im Zuge dessen wurde oft das Ende der Segregation und Rassendiskriminierung gefordert. Während Lynchmorde einst die Rassenverhältnisse zu stabilisieren schienen, bedrohten sie jetzt den Status Quo der weißen Übermacht und bestärkten die Bürgerrechtsbewegung.